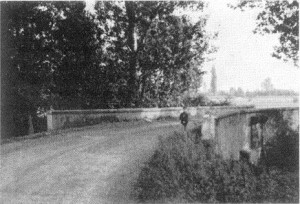Am 13. April 1769 verstarb in Speyer im Alter von 70 Jahren der Domherr und Generalvikar Freiherr Johann Leopold Erasmus von Nesselrode, genannt Hugenpoet. Er entstammte, wie schon der Name verrät, einem niederrheinisch-westfälischen Adelsgeschlecht, das seinen Sitz in dem Gut Hugenpoet bei Düsseldorf hatte. Freiherr von Hugenpoet gehörte schon 1730 dem Speyerer Domkapitel an. Daneben war er auch Domherr zu Hildesheim. Das trug dazu bei, dass er öfters von Speyer abwesend war.
 Hier in Speyer wohnte der Domherr im so genannten “Rollingen-Haus”, einem weiträumigen Anwesen zwischen Weber- und Judengasse (in der Judengasse neben Hausnummer 6 kann man noch heute das Wappen der Freiherren von Rollingen erkennen).
Hier in Speyer wohnte der Domherr im so genannten “Rollingen-Haus”, einem weiträumigen Anwesen zwischen Weber- und Judengasse (in der Judengasse neben Hausnummer 6 kann man noch heute das Wappen der Freiherren von Rollingen erkennen).
Zu den Bediensteten des Freiherrn zählte auch der Jäger Ignaz Diether. Das war zu jener Zeit nichts Außergewöhnliches, da die Domherren adeligen Familien entstammten und trotz ihres geistlichen Amtes auf die Standes-Vorrechte und -Gewohnheiten nicht verzichteten. Außerdem war es damals seit Alters her üblich, dass die neuerwählten Speyerer Fürstbischöfe den Domherren die Jagdausübung in dem fürstbischöflichen Amt Marientraut (zu dem die Gemeinden des damaligen Landkreis Speyer außer Mechtersheim und Otterstadt gehörten) überließen. Dieses Jagdrecht war in den so genannten Wahlkapitulationen niedergelegt. Ein Anwärter auf den Speyerer Bischofsthron musste nämlich – vor seiner Wahl durch die Domherren – dem Domkapitel allerlei Vergünstigungen versprechen, die dann auch in den Wahlkapitulationen schriftlich niedergelegt wurden.
Freiherr von Hugenpoet war ein eifriger Verehrer des hl. Hubertus. Davon zeugt ein “Schusszettel” seines Jägers Ignaz Diether, den dieser zur Abrechnung an den Rechnungsführer des Freiherrn, den Semiprübendar Altdorf, einen niederen Domgeistlichen, übergab. Der “Schusszettel” beginnt mit den Worten: “Was ich zu Hugenboeth geschossen hab Ao (Anno) 1763: im November.” Demnach hielt sich damals der Freiherr mit seinem Jäger in seiner Heimat am Niederrhein auf. Dort schoss der Jäger am 23. November “ein starkes Schwein” (Wildschwein). Sein Schussgeld betrug dafür 1 Gulden 30 Kreuzer. Am 26. und 28. schoss er je eine Schnepfe. Dafür standen ihm 10 Kreuzer zu. Am 29. schoss er ein Feldhuhn (wofür er 10 Kreuzer zu erhalten hatte), am 2. Dezember einen Hasen (10 Kreuzer Schussgeld), am 5. zwei Feldhühner, am 7. und 11. je einen Hasen und am 9. und 13. je ein Feldhuhn. Im Januar 1764 waren der Freiherr und sein Jäger wieder in Speyer. Der Eintrag des Jägers im “Schusszettel” lautete: “Was ich zu Speyer geschossen habe Ao 1764″ am 23. Januar drei Hasen, am 7. Februar zwei Hasen und zwei Feldhühner, am 9. ein Feldhuhn, am 10. zwei Hasen, am 16. fünf Hasen, drei Hühner, am 18. und 20. einen Hasen und ein Feldhuhn, am 4. März zwei Feldhühner, am 8., 10., 21. und 29. je eine Schnepfe, am 23., 24., 26. und 27. je zwei Schnepfen und am 28. zwei Schnepfen und einen Fasan. Zu einem echten Waidmann gehört auch das rechte Essen. Daher der Eintrag im “Schusszettel”: “Was ich auf der Jagd verzehrt habe: im Februar zwei Tage zu Rödersheim – es gehörte bis zur Französischen Revolution dem Domkapitel, dem damit auch das Jagdrecht zustand – auf der Jagd gewesen, habe verzehrt 1 Gulden, dito 3 Tage zu Rödersheim gewesen 1 Gulden 20 Kreuzer”. Dann folgt: “Was ich auf der Schnepfenjagd verzehrt habe” (im März). Hier notierte der Jäger bescheidene Auslagen in Höhe von 15 bis 30 Kreuzer pro Jagdtag. Die Gesamtsumme des “Schusszettels” betrug 15 Gulden 25 Kreuzer. Diesen Beitrag zahlte ihm der Rechnungsführer des Freiherrn am 19. Mai aus. Selbstverständlich lebte der Jäger im Haushalt des Freiherrn und hatte somit Essen und Logis frei. Zum jährlichen Lohn erhielt er 10 Gulden. Hinzu kamen von Zeit zu Zeit neue Kleidung – bzw. Ausstattungs-Stücke, so zum Beispiel 1764 ein Paar neue Schaftstiefel zu 7 Gulden.
Was an Wildbret im Haushalt des Freiherrn nicht gebraucht wurde, wurde verkauft, so zum Beispiel zwei Hasen zu 1 Gulden 8 Kreuzer, 12,5 Pfund Hirsch, das Pfund zu 48 Kreuzer und ein Feldhuhn zu 24 Kreuzer.
Der “Schusszettel” für das Jahr 1765 beginnt mit dem Eintrag: “Was ich zu Speyer geschossen habe.” Er fängt mit dem 4. November – am 3. November ist der Tag des hl. Hubertus, an diesem Tag beginnt die Großjagd – an: einen Hasen – 10 Kreuzer(Schussgeld). Drei Tage war der Jäger im November in Rödersheim gewesen und gab für “Kostgeld” 1 Gulden 30 Kreuzer aus. Am 28. schoss er in Speyer eine Ente und ein Wasserhuhn, für die er als Schussgeld 25 Kreuzer zu beanspruchen hatte. Am 3. Dezember schoss er einen Hasen und ein Feldhuhn (20 Kreuzer), am 6. einen Hasen und eine Schnepfe (20 Kreuzer), am 10. einen starken Frischling (1 Gulden 30 Kreuzer) usw. Im Januar schoss der Jäger zwei Feldhühner und Hasen. Außerdem hatte er zwei Tage in Rödersheim gejagt. Am 25. lieferte er “2 Brüst, ein Bug und 1 Ziemer von einem starken Stück Wildbret”. Ähnlich lautet auch der Eintrag am 8. Februar: “1 Schlegel, 2 Büg und 1 Brust von einem Rehbock geliefert.” (30 Kreuzer). Die letzten Hasen schoss der Jäger am 16. Februar. Von da ab bis zum 24. März ist im Schusszettel nur noch die Schnepfe vertreten. An Kostgeld berechnete er, “was ich in der Schnepfenzeit auf der Jagd verzehrt habe”, für 14 Jagdtage im März (vom 3. bis 24.) 2 Gulden 42 Kreuzer. Im ganzen betrug das Schussgeld für 1765/66 18 Gulden 43 Kreuzer.
Vor Ignaz Diether hatte der Freiherr einen Jäger Joseph Diether, wahrscheinlich einen Verwandten des Ignaz, in seinen Diensten. Dieser hatte bei seinem ehemaligen Dienstherrn ein Kapital von 200 Gulden stehen, von dem er jährlich 5 Prozent Zins, also 10 Gulden an “interesse” bezog. Das war damals allgemein üblich. Der Dienstherr verwaltete das gesparte Geld seiner Dienstboten, auch wenn sie, wie im Fall des Jägers Joseph Diether, ihren Dienst schon quittiert hatten.
Quelle: Beiträge zur Speyerer Stadtgeschichte Heft 1, Fritz Klotz, Stadtgeschichtliche Miszellen